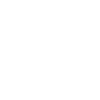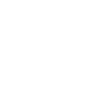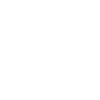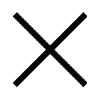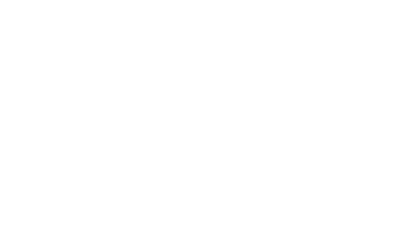

Das Gartenstadtprinzip
Eine revolutionäre Idee
Kleine Gärten zum Gemüse- und Obstanbau, ein Stall für Kleintierhaltung, Bäume und Plätze zum Aufenthalt und Austausch im Grünen und das alles im städtischen Umfeld, mit Lebensmittelläden, Kultur und Kinderbetreuung in der Nähe – dieses Angebot klingt auch heute noch für Viele nach dem idealen Wohnumfeld. Die Idee dahinter ist jedoch schon über 120 Jahre alt und ging noch viel weiter: Die Gartenstadtbewegung wollte das Zusammenspiel von Stadt und Land revolutionieren.
(Foto: Paul-Philipp Braun)
Die Architekten
Louis Mannstaedt beauftragte die Architekten Karl und Dietrich Schulze aus Dortmund mit dem Entwurf der Roten Kolonie. Die Brüder hatten sich bereits einen Namen im Bau von Zechensiedlungen gemacht. Kurz zuvor hatten sie von 1909 bis 1912 unter anderem die Victoria-Siedlung für die Harpener Bergbau AG in Lünen-Nord entworfen. Auch diese Siedlung steht heute unter Denkmalschutz. Bei beiden Werkssiedlungen orientierten sich die Architekten am Prinzip der Gartenstadt. Das gesellschaftliche und städteplanerische Modell wurde 1898 in England von Ebenezer Howard erfunden.
Der Erfinder

Ebenezer Howard wurde 1850 in London geboren. Dort arbeitete er als Parlamentsstenograf und begleitete die politischen Diskussionen zu den Herausforderungen der Industrialisierung. Immer mehr Menschen zogen vom Land in die Stadt, um in den Fabriken zu arbeiten. Dort fehlte es an Platz, sauberem Trinkwasser und an Kanalisation. Die Nähe zu den Fabriken führte zu einer hohen Luftverschmutzung. Mit den steigenden Bodenpreisen wurde immer öfter spekuliert, sodass auch die Mietpreise explodierten. In Deutschland sah es ähnlich aus: Die Zahl der großen Städte von mehr als 100 000 Einwohnern war von fünf im Jahr 1851 auf fast das Zehnfache im Jahr 1910 angestiegen. (Bild: Ebenezer Howard, Howard, Ebenezer, To-morrow: A Peaceful Path to Real Reform, London: Swan Sonnenschein & Co., Ltd., 1898. Public domain)
Bastian Wahler-Zak, Referent im Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung hat sich mit dem Gartenstadtmodell und seiner Übertragbarkeit in die Gegenwart und Zukunft beschäftigt. Er erklärt, welche Fragen sich Howard damals gestellt hat:
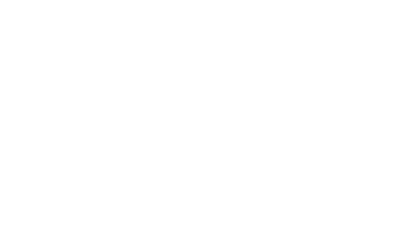
Bastian Wahler-Zak
Mit welchen Fragen beschäftigte sich Ebenezer Howard?
Das Modell
Howard sah neben den Nachteilen in der Stadt auch positive Aspekte wie das breite Kulturangebot oder den öffentlichen Nahverkehr. Dagegen hatte das Land die Vorteile wie frische Landluft, viel Grün, aber fehlende Arbeitsplätze und schlechtere Bildungsangebote. Howard entwarf das Town-Country, das wie ein Magnet die positiven Pole von Stadt und Land anziehen sollte. Auch wenn es physikalisch so einen Magneten nicht gibt, nutzte Howard dieses Bild, um zu veranschaulichen, wie dieser Ort die Vorteile miteinander in Verbindung bringen sollte und die negativen Aspekte aushebeln könnte. Erst mit der Überarbeitung des Modells taucht der Begriff „Garden city“, also Gartenstadt, erstmalig auf. Mit diesem Modell hat er bestimmte Leitprinzipien definiert, so waren die Häuser direkt für mehrere Familien konzipiert. Die einzelnen Gartenstädte sollten sich um die überfüllten und überhitzten Großstädte gruppieren, verbunden durch ein Mobilitätsnetz. Dazwischen sollten Flächen für Landwirtshaft frei bleiben. 1899 entstand die Garden-City-Association, die die Gartenstädte Letchworth und Welwyn nach den Ideen Howards umsetzte.

Howard, Ebenezer, To-morrow: A Peaceful Path to Real Reform, London: Swan Sonnenschein & Co., Ltd., 1898. Public domain
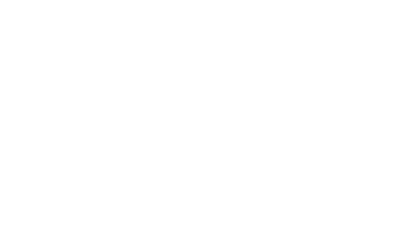
Bastian Wahler-Zak
erklärt das Modell
Wie viel Gartenstadt steckt in der roten Kolonie?

Luftaufnahmen der Roten Kolonie, Foto: Paul-Philipp Braun
Kleine Wohneinheiten, Mehrfamilienhäuser, Selbstversorger-Gärten und ein Versorgungsangebot – all das hat(te) auch die Rote Kolonie zu bieten.
Der Grundgedanke, dass der Gemeinschaft der Grund und Boden gehört und das Freihalten des landwirtschaftlichen Grüngürtels – diese Aspekte wurden nicht umgesetzt.
Der Gartenstadtgedanke in Deutschland
Die Rote Kolonie war damit ganz typisch für die Umsetzung der Idee in Deutschland. 1902 gründete sich die Deutsche Gartenstadtgesellschaft. Der Fokus lag aber schnell eher auf dem gartenbezogenen Wohnen in der Vorstadt nach Genossenschaftsprinzip und dem Verbreiten der Ideen, weniger auf dessen vollständige Umsetzung. „Als einzig echte Gartenstadt, die Industrie, Wohnen und Infrastruktur vereint, wird in Deutschland lediglich die Gartenstadt Hellerau bei Dresden bezeichnet, die zwischen 1907 und 1913 realisiert wurde und reformerisch motivierte Menschen und Künstler aus dem ganzen Land anzog.“ (Quelle: BBSR: 2017, S.32 )
Vor allem Großindustrielle griffen Aspekte des Gartenstadtkonzeptes beim Bau ihrer Werkssiedlungen auf, so wie Louis Mannstaedt beim Bau seiner Kolonien. Vorlage lieferte u.a. die Werkssiedlung Margarethenhöhe, die Margarethe Krupp in Essen in der Nähe des Werks bauen ließ. Die Siedlung hatte trotz vielfältiger Versorgungseinrichtungen, Kultur- und Bildungsangeboten ebenfalls keinen genossenschaftlichen Charakter. (Quelle: Vgl. BBSR, S. 60)
Bastian Wahler-Zak erklärt, warum die Werkssiedlungen sich dennoch am Gartenstadtprinzip orientierten.
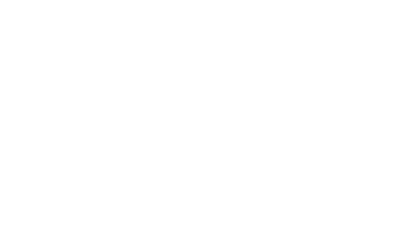
Bastian Wahler-Zak
Warum wurde das Prinzip Gartenstadt von Industriellen beim Bau ihrer Werkssiedlungen aufgegriffen?
Angebot und Nachfrage macht erfinderisch

Dieter Röhl, Foto: Christine Siefer
Dieter Röhl erinnert sich an den Gastwirt Musolf: „Dessen Familie, die auch von Köln nach Troisdorf umsiedelte, unterhielt ein eigenes Kolonialwaren- und Milchgeschäft. Die Familie besaß neben dem Geschäft noch eine Holzhütte mit einer Eismaschine. Alle aus der Kolonie und den angrenzenden Wohngebieten kamen und holten sich dort das köstliche Speiseeis. Wie wird Eis gemacht – das fragten sich viele Kinder und Hans lud sie ein, bei der Herstellung zuzusehen. Nebenher lief das Geschäft mit der Milchverteilung weiter. Er schob dafür einen Handkarren mit großen Milchkannen durch die Siedlung, aus denen er Milch in die vor der Haustür stehenden kleinen Milchgefäße abfüllte. Im Krieg wurde Hans Musolf zum Kriegsdienst einberufen. Es dauerte dann bis nach dem Krieg 1949/50, bis er aus der französischen Gefangenschaft nach Hause entlassen wurde. Die Eisbude rückte dann in den Fokus seiner Geschäfte. Sein Leitgedanke: Eis wird immer gegessen. Es besuchten immer mehr Erwachsene seine Hütte, hielten Schwätzchen, es wurde ein Treffpunkt für Gespräche, die man durch die Kriegserlebnisse etwas verloren hatte. Routiniert wie Hans war, stellte er neben seine Eismaschine einen Kasten Bier. Wie ein Lauffeuer sprach sich das herum. Bald machten die Arbeiter, deren Spätschicht gegen 22 Uhr endete auf dem Nachhauseweg von dem Angebot Gebrauch. In zehn Minuten war man von der Arbeitsstätte bis zur Goldgrube des Durstlöschens. Vorgesehen war meist ein „Schlummertrunk“ und dann ab nach Hause zur Ehefrau, zur Mutter oder Verlobten. Doch der Geist ist zwar willig, aber das Fleisch ist schwach. Es waren auch besonders durstige Kehlen, denn viele arbeiteten an heißen Öfen, mussten mit flüssigem, glühendem Eisen arbeiten oder machten im Walzwerk Akkordarbeiten und kamen dort mit laufenden glühenden Profilen in Berührung. Hans stellte mehr Bänke und einige Stehtische in die Hütte und es wurde immer gemütlicher. Man vergaß die Zeit, bis die Frauen vor der Hütte standen, diese mischten sich aber oft unter die Anwesenden. Hans sah die Entwicklung und beschloss eine Kneipe daraus zu machen. Die kleine Gastwirtschaft wurde 1955 eröffnet. Hans wollte hinter dem Tresen stehen und liebte es mit Menschen zu diskutieren.“
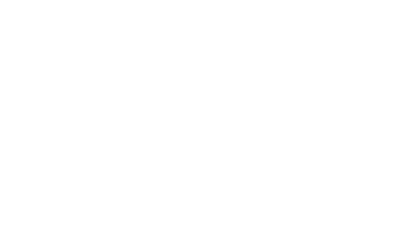

Gartenstadtaspekte heute
Die zwei Obstbäume im Garten und der Stall für Kleinviehhaltung sowie Anbaufläche für Gemüse zahlten sich vor allem in Kriegs- und Krisenjahren aus.
Heutzutage ist das Gärtnern zum Hobby und „Urban Gardening“ zu einem Trendbegriff geworden. Doch es bietet auch mehr als reinen Zeitvertreib. Kleine Selbstversorger-Gärten schaffen mehr Biodiversität, Naturverbundenheit und das Bewusstsein für saisonale Produkte. Große Bäume binden Kohlenstoffdioxid und kühlen die Kolonie im Sommer. Die Idee von Howard eine Gartenstadt mit umliegender Landwirtschaft autark versorgen zu können, ist dennoch weiterhin Utopie. Kleine Anbauflächen können trotzdem Abhängigkeiten von Importware reduzieren und das Bewusstsein für den Wert von regionalen Produkten stärken.
(Foto: Paul-Philipp Braun)
Gärten statt Garagen

Ursula und Ulrich Knab im Garten, Foto: Christine Siefer
Ursula und Ulrich Knab genießen das Grün vor der Tür
Für die Rote Kolonie sollte sich Ende der 70er Jahre entscheiden, ob der ursprüngliche Charme mit kleinen Selbstversorger-Gärten erhalten bleibt oder die Siedlung mit den neuen Eigentümern ihre Einheitlichkeit in Optik und Zusammenleben verliert. An eine schicksalshafte Entscheidung können sich Ursula und Ulrich Knab gut erinnern. Die Wiese hinter den Häuser wurde in kleine Parzellen geteilt und beim Verkauf den Häusern zugeschrieben. Ein großes Stück Grünfläche blieb übrig und der Stadt verkauft. In einer Bürgerversammlung kamen folgende Vorschläge auf den Tisch: Spielplätze, Pachtgärten, Bauland oder Garagen. Auch wenn die Parkplatzsuche viele Bewohner der Kolonie oft verzweifeln lässt, ist man sich heute im Knab`schen Garten einig: Die Entscheidung für die Natur war ein Glücksfall. Ulrich Knab pflegt einen der Pachtgärten und hat dort Gemüse angepflanzt.